Von Freija Geniale
Ein Rückblick auf die Performance-Lesung mit Mareike Fallwickl im Literaturhaus Basel zu ihrem jüngsten Buch «Und alle so still» (2024).
Hinweis: In diesem Text werden geschlechtsspezifische Gewalt und sexualisierte Übergriffe erwähnt.
«Und alle so still» ist ein Buch über einen Care-Streik. Es ist eigentlich ein Roman, aber es ist vielmehr ein Gedankenexperiment mit enormer politischer Sprengkraft. Es ist die Geschichte von Frauen, die sich eines Tages in Stille vor einem Krankenhaus auf den Boden legen und erstmal ziemlich lange nicht wieder aufstehen. Mit der Zeit schliessen sich ihnen immer mehr Frauen an und so kommt schliesslich das gesamte gesellschaftliche System zum Erliegen. Es ist keine Geschichte von lautem Protest. Es ist nicht die Geschichte von mehreren tausend Frauen und genderqueeren Personen, die in violett gehüllt mit gemeinsamen Forderungen auf die Strassen gehen wie jüngst am 14. Juni zum feministischen Streik. Es ist die Geschichte von erschöpften Frauen. Sie erzählt von einer Situation, für die die Menschen keine Sprache haben. Deshalb sind sie so still.
«Es geht nicht darum, dass Frauen aufhören, sich zu kümmern»
Mareike Fallwickl ist österreichische Autorin, Sprachwissenschaftlerin und Mutter von zwei Kindern. Nach «Die Wut, die bleibt» (2023) ist mit «Und alle so still» letztes Jahr ihr zweiter grosser Gesellschaftsroman erschienen, der ebenfalls sehr erfolgreich ist. Beide Romane wurden als Theaterstücke adaptiert und gehören bereits zum zeitgenössischen feministischen Kanon im deutschsprachigen Raum.
Ende April war Fallwickl zu Gast im Literaturhaus in Basel. Das Format ihres Auftritts war dabei für eine Lesung aussergewöhnlich, mutig und radikal: Eine Moderation gab es nicht. Stühle auch nicht. Fallwickl stand während fast 90 Minuten auf der Bühne und machte die Lesung zur Performance. Sie erläuterte Hintergründe zu Textstellen im Roman und zu den Figuren, erzählte von der Entstehung des Buches, ordnete zahlreiche Stellen im Roman politisch und historisch ein oder nannte interessante Fakten zu den zentralen Themen ihres Romans. So erzählte sie beispielsweise, dass sich lediglich 3.5% einer Bevölkerung an einem Streik beteiligen müssten, um ein System vollständig zum Erliegen zu bringen.
Lediglich 3.5% einer Bevölkerung müssten sich an einem Streik beteiligen, um ein System vollständig zum Erliegen zu bringen.
Die Vergeschlechtlichung formeller und informeller Fürsorgearbeit spielt eine zentrale Rolle in «Und alle so still». So schliessen sich die streikenden Menschen in einer grossen alternativen Gemeinschaft zusammen, sorgen füreinander – und verlassen so aber das System. In diesem Zusammenhang führen sie Gespräche darüber, dass Fürsorge doch eigentlich etwas Positives ist und weshalb sie eigentlich streiken. Dabei fällt folgender Satz: «Es geht nicht darum, dass Frauen aufhören sich zu kümmern. Es geht darum, dass Männer endlich auch damit anfangen.»
Füreinander-Da-Sein sei in unserer Gesellschaft so eng mit Weiblichkeit verknüpft, führt Fallwickl aus, dass wir alle dies in unserem Verhalten konstant reproduzieren würden. So würden Männer häufig die damit einhergehenden Ungleichheiten gar nicht bemerken. Während Frauen sich in den letzten Jahrzehnten mehr Zugang zum Arbeitsmarkt erkämpften, sich daran anpassten und seither massive Mehrfachbelastungen durch Lohnarbeit und unbezahlte Care-Arbeit bewältigen, mussten Männer gar nicht viel verändern, um in den sich wandelnden wirtschaftlichen Strukturen bestehen zu können. Fallwickl kommentiert: «Und dann fragen wir uns alle ‘Huuuch, wo kommen denn jetzt diese ganzen Männer her, die alle gar keinen Zugriff auf ihre Gefühle haben?’ Aber das waren wir alle. Das waren wir alle mit unserer Sozialisierung.»
Da Männer viel weniger lernen (müssen), fürsorglich zu sein oder mit den eigenen Emotionen umzugehen, ziehen die Frauen in Fallwickls Roman die Wut von Männern auf sich, die nicht verstehen können, weshalb sie ihre Arbeit verweigern. Als Folge dieser Wut erleben die Frauen erneut brutale, rohe Gewalt von erzürnten Männergruppen. Frauen, die Gewalt und Ausbeutung erleben, erfahren also noch mehr Gewalt, wenn sie es wagen, sich dagegen zu wehren. Fallwickl zeigt eindrücklich auf, dass es kaum ein Entkommen aus dem patriarchalen System gibt: Egal, ob du dich wehrst oder nicht, Gewalt bist du so oder so ausgesetzt.
«Keine Frau ist gut genug für das Patriarchat»
Ihre Geschichte erzählt Fallwickl in Österreich und aus der Perspektive von drei verschiedenen Hauptfiguren: Ruth, eine Pflegefachfrau in ihren 50ern, die jahrzehntelang ihren Sohn mit Behinderung gepflegt hat und im Krankenhaus arbeitet. Elin, eine Influencerin anfangs 20, deren Mutter ein Hotel betreibt, in dem Elin auch lebt. Und Nuri, ein junger Mann mit Migrationsgeschichte und ohne Schulabschluss, der sich in äusserst prekären Arbeitsverhältnissen und mit mehreren Jobs über Arbeitsvermittlungsapps über Wasser hält. Durch die unterschiedlichen Figuren wird die Verschränkung von Misogynie, Rassismus, Machtstrukturen und Ausbeutung sehr vielschichtig und differenziert erzählt.
Dass bei einem feministischen Roman über einen Care Streik eine von drei Hauptfiguren ein migrantisierter junger Mann ist, der enorm unter den Erwartungen des Patriarchats an Männer leidet und sogar einen sexualisierten Übergriff durch eine Frau erlebt, ist eine der grossen Stärken dieses Buches. Denn so thematisiert Fallwickl einerseits die transnationale Verschiebung von schlecht bezahlter oder unbezahlter Fürsorgearbeit im Kontext des sogenannten «Care Drain» von (vorrangig) Frauen ohne auf Frauen mit Migrationsgeschichte. Zugleich wird am Beispiel von Nuri deutlich, wie das Patriarchat auch Männern schadet. Währenddessen scheint Elin, die erfolgreiche Influencerin, die Schönheitsideale erfüllt und sogar mit ihren Followern schläft, allen Ansprüchen des Patriarchats an Weiblichkeit zu entsprechen. Doch auch sie erlebt Gewalt. Fallwickl sagt in der Lesung, dass sie mit Elin zeigen wollte, dass keine Frau gut genug ist für das Patriarchat, egal wie sehr sie seine Ansprüche zu erfüllen versucht.
Jede Figur wird im Laufe des Romans lebendig und glaubhaft entwickelt und erzählt. Langsam entspinnen sich Beziehungen und Verflechtungen zwischen den verschiedenen Hauptfiguren. Es geht um Mutter-Tochter Verhältnisse, leise lesbische Liebesgeschichten bahnen sich an, eine Frau lehnt sich gegen ihren gewalttätigen Mann auf und wird von ihrem Sohn dabei unterstützt. Jede Figur ist wie ein einzelner Strang, der sich im Geflecht der manchmal wirren Ereignisse um diesen Care Streik und des darauffolgenden Systemkollaps einfindet. Die Tonalität der Erzählung ist faszinierend. Es gelingt Fallwickl mit enormer Wortgewalt, den Leser*innen ein Gefühl für diese überfordernde, intensive Situation zu vermitteln, sodass der Eindruck entsteht, mensch erlebe mit, was beschrieben wird.
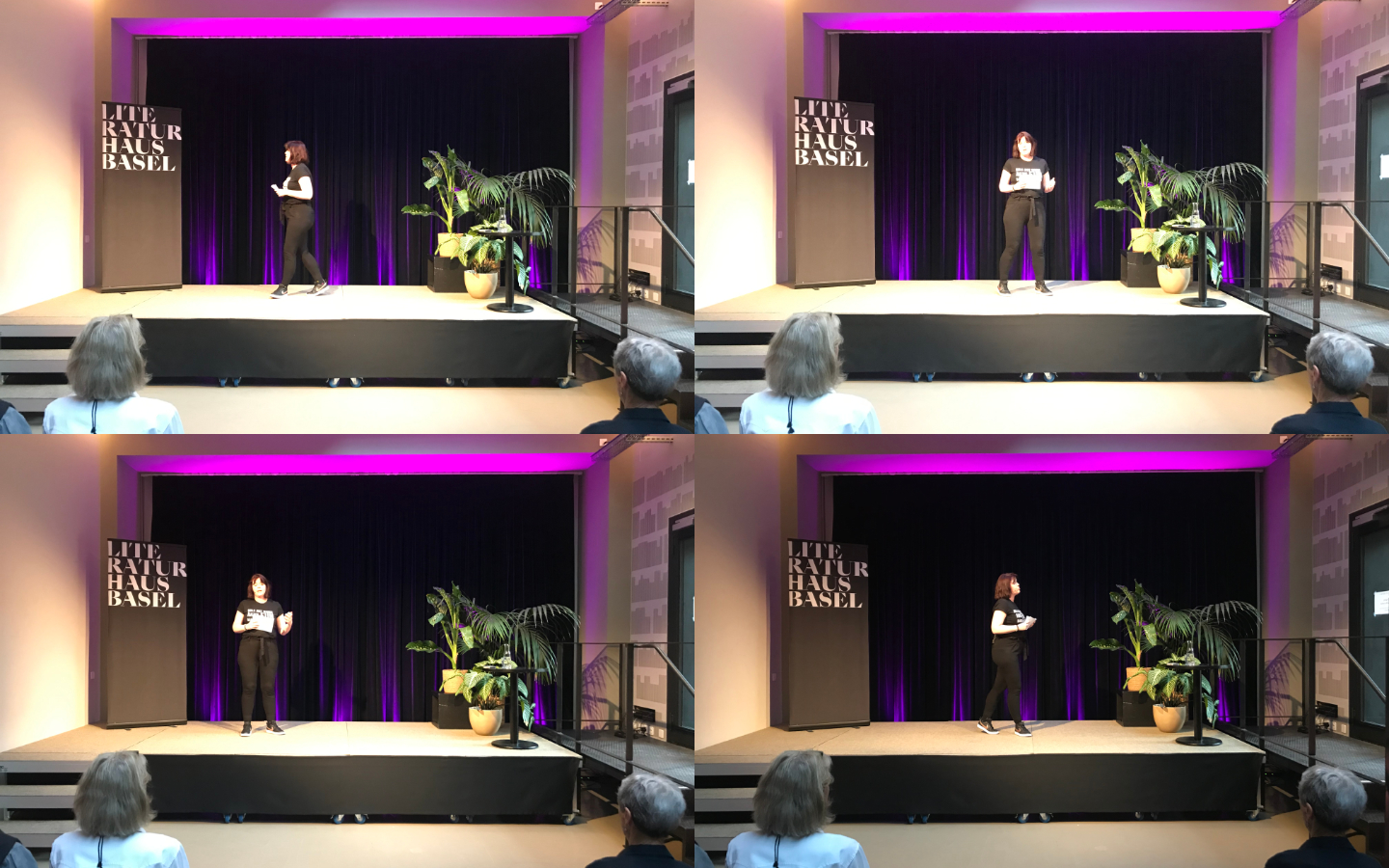
Was heisst es, moralisch richtig zu handeln?
Eine Besonderheit an Mareike Fallwickls Romanen ist, dass sie mit ihren Romanfiguren nicht unbedingt eine moralische Position ergreift. Sie traut sich, ihre Figuren, mit denen wir als Leser*innen uns vielleicht schon das ganze Buch über identifizieren, Dinge tun zu lassen, die wir moralisch nicht unbedingt als «richtig» benennen würden. Es ist ein Motiv, das sich bereits in «Die Wut, die bleibt» gezeigt hat und in «Und alle so still» nochmals ausgeprägter zum Vorschein kommt. So lässt Fallwickl in «Die Wut, die bleibt» die junge Hauptfigur Lola sich einem feministischen Kollektiv anschliessen, das Täter von sexualisierter Gewalt brutal verprügelt. Die Leser*innen können sich über den Verlauf der Geschichte zunächst mit der jungen Lola identifizieren, gehen mit ihrer Entwicklung mit und werden dann auf einmal vor den Kopf gestossen. Sie können vielleicht ihren Entscheidungen nicht mehr folgen und stehen vor der Frage, inwiefern sie es moralisch vertretbar finden, auf Gewalt mit Gewalt zu reagieren. Mit dem eigenen schlechten Gewissen für Lola werden die Leser*innen gänzlich allein gelassen.
Nur, weil eine Figur feministische Perspektiven aufzeigt oder ein Roman als feministisch gelabelt wird und wir als Leser*innen dies vielleicht positiv assoziieren, heisst das nicht, dass die starken weiblichen oder genderqueeren Hauptfiguren in diesen Romanen unbedingt moralisch korrekt handeln. Mit diesen radikalen Wendungen stösst Fallwickl einen tiefergehenden Reflexionsprozess an.
In «Und alle so still» wird dieses Motiv besonders in der Erzählung rund um das Krankenhaus im Care-Streik deutlich. Immer mehr Frauen aus der Pflege verlassen während des Streiks das Krankenhaus und überlassen die kranken und verletzten Menschen ohne medizinische Versorgung ihrem Schicksal. Hauptfigur Ruth jedoch bringt das als eine von wenigen nicht über sich. Sie schuftet bis zum völligen Erschöpfungszusammenbruch und versucht verzweifelt und erfolglos die Patient*innen fast allein zu versorgen. Die Frauen, die das Spital verlassen haben, kommen vorbei, bringen ihr Essen und frische Kleider, lassen sie dann aber wieder allein. Die Beurteilung dieser Situation bleibt den Lesenden überlassen: Ruth hat durch ihre Arbeit in der Pflege und die Betreuung ihres behinderten Sohnes ihr Leben lang Fürsorgearbeit geleistet. Ruths Verbleiben im Krankenhaus könnte also als ein Nicht-Herausfinden aus den patriarchalen Erwartungen und Zuschreibungen gedeutet werden. Zugleich sind es ganz furchtbare Szenen, die aus diesem verlassenen Krankenhaus beschrieben werden. Stellenweise ist es kaum auszuhalten. Menschen werden in ihrem Elend alleine gelassen und sterben, obwohl sie in einem funktionierenden System gesund werden könnten. So gesehen müsste Ruths Verhalten als ethisch richtig betrachtet werden im Gegensatz zur Verweigerung der anderen streikenden Mitarbeiterinnen. Oder doch nicht? Die Bewertung überlässt Fallwickl letztlich den Lesenden. Sie gibt keinerlei Interpretationshilfe, sondern erzählt lediglich, was passiert.
Mitgefühl und Fürsorge machen uns besonders verletztlich und ausbeutbar, so liesse sich dieses sichtbar werdende Dilemma auf den Punkt bringen.
Mich hat dies beim Lesen überfordert zurückgelassen. Einerseits habe ich Wut darüber empfunden, dass es ausgerechnet Ruth sein muss, die sich im Krankenhaus allein kaputt arbeitet. Ruth, die sich eben ihr Leben lang aufgrund ihres Berufs, ihrer Lebensumstände und ihrer Sozialisierung aufopfert und im Zuge dessen die Fürsorge für sich selbst fast völlig aufgibt. Zugleich konnte ich sehr gut verstehen, dass gerade sie es nicht über sich bringt, die schwerkranken Menschen sich selbst zu überlassen. Mitgefühl und Fürsorge machen uns besonders verletztlich und ausbeutbar, so liesse sich dieses sichtbar werdende Dilemma auf den Punkt bringen.
Es ist ein enorm kraftvolles Setting, das Fallwickl da gebaut hat, das so viele Fragen aufwirft zu Geschlechterrollen und -normen, zu Verantwortung, zu Moral und zum Zustand des Pflegeberufs als Ausdruck der gesellschaftlichen Geringschätzung von Care Arbeit. Fallwickl greift das Thema Streik im Gesundheits- und Sozialwesen auch in ihrer Performance nochmals auf. Sie führt aus, dass Streik stark männlich konnotiert sei und sich oft auf Felder wie «Piloten oder Lokführer» beziehen würde. Sobald es jedoch um Menschenleben gehe, die von einem Streik betroffen wären, würden Konzerne die Moralkarte ziehen. Dabei würden Menschen auch aufgrund des aktuellen Pflegemangels sterben, und zwar «mehr als ihr denkt», wie Fallwickl sagt. Es gäbe aber leider (noch) keine präzisen Zahlen dazu. Alle Stellen im Buch, die die Situation der Pflege in Krankenhäusern thematisieren, sind aus Interviews mit Pflegefachpersonen entstanden, die sich ihr für die Entstehung des Buches zur Verfügung gestellt haben. Somit haben die scheinbar überspitzten Situationen in der Erzählung letztlich einen sehr realen Ursprung.
«Das Verweigern hat die Zukunft geöffnet, und jetzt. Jetzt ist sie offen.»
Mit diesen Worten findet die Erzählung schliesslich ihr Ende. Dass es gelingt, eine so dystopische Geschichte zu erzählen und dennoch hoffnungsvoll zu enden, ist beeindruckend. Am Ende bleibt ein Gefühl von Hoffnung, Solidarität und Gemeinschaft. Aber der Weg dahin war ein ganz anderer als der, den ich vor dem Lesen erwartet hätte. Ich hatte eine sehr andere Vorstellung von einem Buch über einen Care Streik. Ich hatte mir etwas Geplantes, Koordiniertes vorgestellt. Doch in «Und alle so still» legen sich Frauen spontan und unkoordiniert zu Boden, weil sie nicht mehr können. Relativ schnell kommt das gesamte System zum Erliegen. In der Performance-Lesung sagt Fallwickl, sie habe im Roman mehrere Tage, ja fast eine Woche, vergehen lassen, bis das System kollabierte. In Wirklichkeit würde dies deutlich schneller gehen. Als das System dann nicht mehr funktioniert, haben die protestierenden Menschen auf einmal sehr viel (mediale) Aufmerksamkeit. Andere Frauen fordern sie auf, jetzt zumindest Forderungen aufzustellen. Die Antwort der Protestierenden hat mich selbst beim Lesen überrascht. Sie sagen:
«Vielleicht sind wir am Ende angelangt. […] Es waren die letzten Kräfte. […] Das ganze System beruht auf unserer Verfügbarkeit. Unserer Körper, unserer Kraft, unserer Zeit. Diese Verfügbarkeit zu entziehen, ist die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt.» (Fallwickl, Und alle so still, S. 175)
Und weiter:
«Ein Streik ist das nicht, was wir hier machen. […] Ein Streik ist organisiert und geht mit Forderungen einher. Jemand sagt, ich will mehr Geld, ich will bessere Bedingungen, sonst gebe ich euch nicht mehr das, was ihr von mir braucht. Und dann wird verhandelt. Aber mit wem sollten wir verhandeln und worüber? Wir haben doch alles versucht. Wir haben verlangt, dass Care-Arbeit aufgewertet wird, dass wir die gleiche Bezahlung erhalten für die gleiche Arbeit, wir haben gefordert, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden, dass es besseren Schutz gibt vor Femiziden. Nichts hat sich verändert. Hinter allen Arten des Unrechts steckt dasselbe Problem, dass wir nicht gehört, nicht gesehen, nicht geachtet werden. Und es gibt keinen Grund mehr, dass wir weitermachen wie bisher.» (ebd., S. 173)
In der Performance-Lesung sagt Fallwickl, sie habe im Roman mehrere Tage, ja fast eine Woche, vergehen lassen, bis das System kollabierte. In Wirklichkeit würde dies deutlich schneller gehen.
Ich bin erstaunt darüber, wie sehr mich diese Antwort überrascht hat. Es ist für mich so selbstverständlich, dass Frauen und genderqueere Menschen nicht nur Lohnarbeit und Care Arbeit, sondern auch politische Arbeit leisten, dass diese totale Verweigerung für mich völlig unerwartet kam. Es ist selbstverständlich, dass wir FINTA-Personen[1] uns organisieren und Forderungen aufstellen, dass wir Demonstrationen organisieren und Reden vorbereiten, Merch drucken und verteilen, feministische Songs schreiben, Panels vorbereiten, Videos drehen und Newsletter verschicken, so wie kürzlich in der Vorbereitung auf den 14. Juni. Dass wir feministische Romane schreiben, Studien durchführen, Statistiken erstellen, Lohnungleichheitsanalysen durchführen, Kollektive gründen, unsere Botschaften an Hauswände sprayen. Dass wir uns zu Mahnwachen zusammenfinden bei jedem weiteren Femizid, dass wir Transparente malen für den 8. März, dass wir Sachbücher schreiben und landauf landab unsere Forderungen in die Medien und die Öffentlichkeit tragen, dass wir Schulungen konzipieren und unser Wissen weitergeben. Dass wir uns feministisch organisieren und kämpfen für eine gerechtere Welt, für weniger geschlechterbasierte Gewalt und weniger Ausbeutung, hier und auf der ganzen Welt, jeden Tag.
All das ist für mich so selbstverständlich und meinem Verständnis von Feminismus so inhärent, dass ich diese Stelle in Fallwickls Roman nicht kommen sah. Ich habe nie über die Möglichkeit nachgedacht, dass Feminist*innen vielleicht irgendwann einfach keine Energie mehr haben, weiterzukämpfen. Auch die politische Arbeit, die wir leisten, wird zu einem grossen Teil unbezahlt geleistet. Und noch dazu wird sie geringeschätzt, belächelt und aktiv bekämpft. Was Fallwickl in dieser Situation beschreibt, ist im Grunde ein kollektives Burnout. Die Frauen wollen und können keine Forderungen mehr aufstellen. Sie haben den Glauben daran, dass sie gehört werden, verloren. Das ist eine so eindrückliche Botschaft und macht dieses Gedankenexperiment zu etwas ganz Besonderem. Die Protestierenden sind nicht laut. Sie sind erschöpft. Die Stille, als die Frauen auf dem Boden vor dem Krankenhaus liegen, ist unendlich laut.
«Und alle so still» ist unvergleichlich kraftvoll, radikal und absolut kompromisslos. Es beleuchtet zahlreiche unterschiedliche Facetten von Geschlechterungleichheit und Ausbeutungsverhältnissen sowie von Gemeinschaft, Fürsorge und feministischer Solidarität. Es ist ein zutiefst antikapitalistisches Buch, das Klassenverhältnisse nicht, wie feministische Literatur es sonst häufig tut, ausblendet, sondern explizit benennt und kritisiert und dabei stets eine intersektionale Perspektive einnimmt. Dieses Buch macht vieles richtig, ist augenöffnend und zutiefst prägend. Eine ganz grosse Leseempfehlung im Nachgang zum feministischen Streiktag.
Bemerkungen
[1] FINTA steht für Frauen, inter, nonbinär, trans und agender Personen.
Beitragsbild: Feministischer Streiktag in Zürich, 14. Juni 2019. Foto von Claudio Schwarz auf Unsplash.


