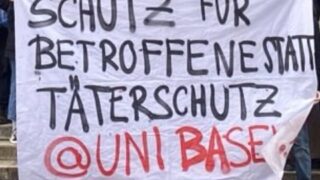Von Dominique Grisard. Ein Interview mit Barbara Weber über ihre Inszenierung von «Prima Facie» am Schauspielhaus Zürich.
«Jede Frau erfährt irgendwann in ihrem Leben eine Form von sexualisierter Gewalt, ihnen muss geglaubt werden, damit es Gerechtigkeit geben kann. Jede Frau. Sehen Sie nach links, sehen Sie nach rechts, jede von uns.»
– Aus dem Drehbuch «Prima Facie» von Suzie Miller, 2024, S. 27
Dominique Grisard: Das Theaterstück «Prima Facie» ist ein Monolog. Die Hauptdarstellerin, Tessa Ensler, erzählt von ihrer Karriere als Anwältin, von ihrer Vergewaltigung durch einen Mitarbeiter und dem anschliessenden Strafverfahren.
Was war Deine Motivation, «Prima Facie» zu inszenieren? Wie ist Dir das Stück begegnet?
Barbara Weber: Bei dem Stück «Prima Facie» verhandelt die Autorin Suzie Miller das Thema sexualisierte Gewalt an einem konkreten Fall über 90 Minuten aus der Perspektive einer Frau – ich mochte die gesellschaftliche Dringlichkeit, Aktualität und Relevanz in der klassischen Form eines Monologes.
Das Stück gibt Mut, überhaupt darüber zu sprechen, die Scham abzulegen, Stimmen zu hören, die oft überhört werden. Das hat sich gerade in den zahlreichen Debatten nach dem Stück gezeigt. Diese waren sehr gut besucht und die Leute blieben bis zum Schluss und haben sich an der Diskussion beteiligt.
Das Stück kam als Regieauftrag aus der Dramaturgie des Schauspielhauses Zürich zu mir. Und mit der grossartigen Alicia Aumüller! Ich musste einfach zusagen.
Beim wiederholten Lesen hat mich das Stück durch die klare und emotionale Erzählweise überzeugt, die das Thema auf eindringliche Weise für Menschen und Perspektiven zugänglich macht. Mir war wichtig, dass wir ein möglichst breites Publikum ansprechen können mit diesem Thema.
Beim wiederholten Lesen hat mich das Stück durch die klare und emotionale Erzählweise überzeugt, die das Thema auf eindringliche Weise für Menschen und Perspektiven zugänglich macht.
Grisard: Was war Dir wichtig, in der Art und Weise, wie (und mit wem) Du «Prima Facie» inszeniert hast?
Weber: Alicia Aumüller war fast die Voraussetzung für diese Arbeit. Wir arbeiten seit 2008 immer wieder zusammen. Uns verbindet eine lange Zusammenarbeit zu Frauenfiguren in dramatischen Stoffen und zu feministischen Lesarten auch von klassischen Stücken.
Grisard: Der globale und auch schweizweite Erfolg des Theaterstücks lässt darauf schliessen, dass geschlechterspezifische sexualisierte Gewalt auf ein breites gesellschaftliches Interesse stösst. Das erstaunt. Verhandelt das Stück doch ein Thema, das die patriarchalen Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft explizit benennt und kritisiert. Man würde es entsprechend eher auf kleinen, alternativen Bühnen erwarten. Es sind aber durchweg im bürgerlichen Kulturbetrieb etablierte Schauspielhäuser, an denen das Stück inszeniert wird.
Wie erklärst Du Dir den weltweiten Erfolg von «Prima Facie»?
Weber: Der weltweite Erfolg von «Prima Facie» lässt sich durch die doch kraftvolle Verbindung aus aktueller Thematik – der Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt und dem Justizsystem – und einer eindringlichen Solo-Performance erklären. Die emotionale Tiefe und auch die «universelle» Relevanz des Stücks treffen ein breites Publikum und regen zur gesellschaftlichen Diskussion an.
Grisard: Warum gerade jetzt?
Weber: Das Theater reagiert auf eine öffentliche Debatte. Ein Stück gibt diesen aktuellen Themen eine persönliche und menschliche Stimme und trifft damit einen Nerv der Zeit.
Grisard: Justin Martin, der Regisseur der Uraufführung von «Prima Facie» in London, meinte, Theater kreiere Empathie und wenn wir Empathie unter/bei Männern erzeugen, dann würde dies zu gesellschaftlichem Wandel in der Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt beitragen. Von einer ähnlichen These geht übrigens die feministische Performancekünstlerin Suzanne Lacy aus, deren Videoinstallation «De tu puño y letra (By Your Own Hand)» derzeit im Tinguely Museum gezeigt wird. In diesem Video lesen männlich gelesene Personen in einer Stierkampfarena Auszüge aus Briefen von Frauen und Kindern, die ihre Erfahrungen mit geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt beschreiben.
Welches Potential siehst Du im Theater?
Weber: Der Monolog ist pur, fokussiert auf die Spielerin und den Text. Das hat eine grosse Konzentration und Wirkung, um das Publikum emotional zu erreichen und zu kritischem Denken zu bewegen. Vielleicht funktioniert gerade im Gegenzug zu schnellen medialen Rezeptionen diese stark reduzierte klare Setzung, um relevante Diskurse eindringlicher zu eröffnen.
Grisard: Was beobachtest Du am Theater, hinter der Bühne so zu sagen? Gibt es ein Bewusstsein, eine Sensibilisierung über sexualisierte Gewalt am Theater?
Weber: Im Betrieb Theater selber wächst langsam das Bewusstsein für sexualisierte Gewalt. Lange verfestigte Machtstrukturen und Dynamiken werden thematisiert. Es werden langsam aber sicher institutionelle Veränderungen angeschoben und umgesetzt. Geschlechter- und machtkritische Perspektiven rücken immer mehr ins Zentrum.
Auf der Bühne ist man leider immer etwas weiter als hinter der Bühne…
Mit klarer, direkter Sprache und konkreten Beispielen zeigt Suzie Miller, wie das Rechtssystem strukturelle Ungleichheiten reproduziert – eindringlich, aber nie belehrend.
Grisard: Miller geht es nicht nur um individuelle Affekte – Betroffenheit, Empathie, Wut. Sie kritisiert gesellschaftliche Strukturen der klassenspezifischen und sexistischen Diskriminierung und wie sie sich im Recht spiegeln. Neben Geschlecht ist auch Klasse entscheidend für die Figur von Tess, die im Unterschied zum Täter auf kein ‚Old Boys Network‘ zurückgreifen kann. Auch in der Schweiz bleiben Klassendifferenzen häufig unsichtbar – der Mythos, wir alle seien Mittelschicht und hätten die gleichen Möglichkeiten, herrscht vor.
Wie gelingt es der Autorin Suzie Miller Deiner Meinung nach diese komplexe Struktur von Recht, Klasse und Geschlecht zugänglich zu formulieren?
Weber: Durch die klug gebaute persönliche Geschichte der Protagonistin Tessa werden abstrakte Themen wie Recht, Klasse und Geschlecht emotional erfahrbar. Mit klarer, direkter Sprache und konkreten Beispielen zeigt Suzie Miller, wie das Rechtssystem strukturelle Ungleichheiten reproduziert – eindringlich, aber nie belehrend.
Grisard: Welche Aspekte standen für Dich im Rahmen der Inszenierung besonders im Fokus?
Weber: In der Inszenierung am Schauspielhaus Zürich standen für mich ein vielschichtiges, genaues Kammerspiel, welches möglichst unter die Haut geht, im Zentrum. Dann kam die eindringliche Präsenz von Alicia Aumüller hinzu, die in ihrer «Solo-Rolle» als Tessa so beeindruckend zwischen Anwältin, Zeugin und Betroffene wechselte. Sie trug den Abend allein! Mit ihrem Körper, ihrer Stimme und ihrer eindringlichen und emotionalen Wandlungsfähigkeit – und schaffte es, das Publikum über die gesamte Spieldauer hinweg zu fesseln. Unterstützt wurde ihre Darstellung lediglich durch ein reduziertes Bühnenbild, das mit ganz wenigen Requisiten wie ein Bett, ein Stuhl auskam. Durch Projektionen von Handyfotos sowie gezielt eingesetzte Video- und Lichtelemente wollte ich Tessas innere Zerrissenheit sichtbar machen. Sie spiegelten den Kontrast zwischen ihrem privaten und beruflichen Leben. Die musikalische Gestaltung betonte emotionale Höhepunkte und machte dramaturgische Brüche spürbar.
Grisard: Bist Du zufrieden mit der Resonanz?
Weber: Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz – wir haben enorm viele Briefe und Rückmeldungen bekommen. Es berührt mich und auch Alicia, wie viele Menschen sich persönlich angesprochen fühlten und den Mut gefunden haben, ihre Gedanken zu teilen.
Beitragsbild: Alicia Aumüller in «Prima Facie» von Suzie Miller. Foto: © Philip Frowein / Schauspielhaus Zürich.