Von Freija Geniale. Ein Interview mit Sascia Bailer über ihr Buch «Caring Infrastructures».
Der Begriff «Care» ist in den letzten Jahren zu einem gesellschaftspolitischen und feministischen Schlagwort geworden. Dabei sind unterschiedliche Dinge gemeint, zum Beispiel Fürsorgearbeit bei Angehörigen, Inklusivität am Arbeitsplatz, die Krisen im Gesundheits- und Wirtschaftswesen (Stichwort «Wirtschaft ist Care»), die schlechte Bezahlung von Pflegenden (Stichwort «Pflege-Initiative») oder politische Solidarität als eine Art der Fürsorge. All dem gemeinsam ist die zentrale Einsicht, dass wir Menschen existenziell voneinander abhängig sind und diese Tatsache sowie die Arbeit der gegenseitigen Fürsorge kaum anerkannt wird.
Dr. Sascia Bailer ist Künstlerin, Autorin und Wissenschaftlerin und beschäftigt sich mit Themen an der Schnittstelle von Care, zeitgenössischer Kunst und strukturellem Wandel. Sie hat ihren PhD in Practice in Curating an der Zürcher Hochschule der Künste und der Universität Reading abgeschlossen. In den Jahren 2019/20 war sie künstlerische Leiterin der gemeinnützigen Kunststiftung M.1 Arthur Boskamp-Stiftung in Hohenlockstedt in Norddeutschland, wo sie ein partizipatives Programm zu care entwickelte und welches sie im Rahmen ihrer Doktorarbeit wissenschaftlich untersuchte.
Aus diesem Forschungsprozess ist die Monografie «Caring Infrastructures. Transforming the Arts Through Feminist Curating» (2024, transcript Verlag, open access) entstanden. Darin setzt Bailer sich mit Care als soziale Praxis und als Methode des Kuratierens auseinander. Entstanden ist ein Werk, das einerseits aufzeigt, wie eng verflochten und politisch aufgeladen die Themen Kunst, Care und Kuratieren sind und andererseits, wie eine solidarische, feministische und fürsorgliche Zukunft aussehen könnte. Am 27. Januar ist sie im feministischen salon basel zu Gast. Ich habe sie im Vorfeld auf ein Gespräch getroffen.
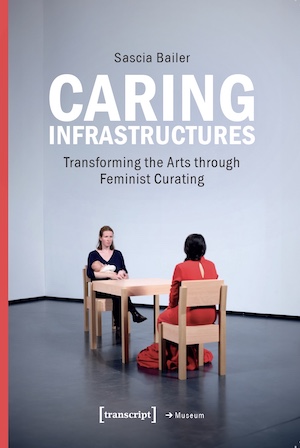
Freija Geniale: In Deinem Buch «Caring Infrastructures» kritisierst Du, dass der Kunstbetrieb das Thema Care in den letzten Jahren zwar diskursiv immer mehr aufgreift, aber seine eigenen Strukturen zugleich kaum verändert. Das ist ein Phänomen, das als «Care Washing» bezeichnet wird, analog zu Begriffen wie «Green Washing» oder «Pink Washing». Was war der Ausgangspunkt für diese kritische Auseinandersetzung in Deiner Forschung?
Sascia Bailer: Ich bin anfangs gar nicht so stark konzeptionell an die Fragestellung herangegangen, sondern vielmehr aus einer persönlichen Position heraus als Alleinerziehende, die sich gezwungenermassen mit Fragen rund um Care auseinandersetzt und dann als Wissenschaftlerin sieht, dass meine Situation auch Ausdruck von einem grösseren System und seinen Ungleichheiten ist. Dann brach die Pandemie aus und da ist für mich diese Diskrepanz unübersehbar geworden: Wie schnell sowohl Medien, Politik, aber eben auch der Kultursektor sich dieser Care-Rhetorik angenommen haben, ohne dass es nennenswerte strukturelle Veränderungen gegeben hätte. Dann wird das Sprechen über Care zur Farce oder eben zu Care-Washing, einem Begriff, den das Londoner Care-Kollektiv geprägt hat.
Ich fand das eine spannende Perspektive, durch die man die Pandemie, aber auch Dynamiken im Kultursektor betrachten konnte: Seit der Pandemie sind immer mehr Kulturveranstaltungen zum Thema Care aufgekommen. Aber in den meisten Fällen wird nicht mitverhandelt, wie eigentlich die veranstaltende Organisation oder Institution sich selbst organisiert, welche Hierarchien bestehen, wo Ungleichheiten strukturell verankert sind, die dem Gedanken der feministischen Care Ethik, dass wir alle Fürsorge empfangen und geben, widersprechen. Wir brauchen zwar eine diskursive Verhandlung von Gesellschaft, Kunst und Care. Aber wir müssen uns als Kultursektor, als Organisationen, als Kollektive, als Einzelakteur*innen unbedingt in die Betrachtung miteinbeziehen.
Geniale: Du erwähnst in Deiner Forschung stets «Care-Givers», aber auch «Care-Receivers»[1]. Magst Du erläutern, warum es dir wichtig ist, diese Perspektive mitzuberücksichtigen und inwiefern die Beachtung von Care-Receivers, also Menschen, die auf Fürsorge angewiesen sind, über die Idee von Inklusion im herkömmlichen Sinne hinausgeht?
Bailer: Die Begriffe Care-Givers und Care-Receivers sind zentral in der feministischen Care-Ethik, welche unter anderem von der US-amerikanischen Politikwissenschaftlerin Joan Tronto geprägt wurde. Es ist spannend, dass Tronto diese beiden Begriffe stets zusammen denkt. Es geht bei ihr darum, dass wir Menschen uns nicht als rein autonome Subjekte verstehen können, die von der Care-Thematik ausgeklammert werden könnten. Tronto geht vielmehr davon aus, dass wir alle in Fürsorgebeziehungen miteinander stehen und unterschiedliche Bedürfnisse haben, die mitbedacht werden sollten. Aus diesem Blickwinkel ist der Inklusionsgedanke keine separate Sache. Wir müssen in unserer Kulturarbeit dann beispielsweise nicht mehr die Zielgruppen «Eltern» oder «Menschen mit Behinderungen» einzeln mitdenken, sondern – wenn wir diesen Care-Gedanken ernst nehmen – dann gehören sowieso alle Menschen in ihren verschiedenen Bedürfnissen mitgedacht.
Besonders ist dabei, dass häufig Synergieeffekte zwischen den Support-Strukturen entstehen: eine Rampe kann Zugänge für Menschen im Rollstuhl als auch für Menschen mit Kinderwägen ermöglichen.
Besonders ist dabei, dass häufig Synergieeffekte zwischen den Support-Strukturen entstehen: eine Rampe kann Zugänge für Menschen im Rollstuhl als auch für Menschen mit Kinderwägen ermöglichen. Eine Kinderbetreuung bei Veranstaltungen kann verschiedenen sozialen Gruppen gleichzeitig die Teilhabe ermöglichen: die Künstlerin, die mit Kind anreist, hat so eine Betreuung vor Ort; die Teilnehmenden können das Angebot für ihre Kinder nutzen, aber auch Kulturschaffende von der veranstaltenden Institution können dadurch bei Wochenend-Programmen entlastet werden. Nimmt man also dieses soziale Ökosystem aus unterschiedlichen Care-Bedürfnissen ernst, kann man verschiedene Angebote machen, die unterschiedliche Gruppen gleichzeitig zugutekommen.
Geniale: Du beziehst dich an mehreren Stellen auf Joan Trontos eher normativen Care-Begriff, der Care als Tätigkeit versteht, die unsere Welt erhält, fortführt und repariert, «damit wir so gut wie möglich darin leben können». Gleichzeitig betonst Du im Unterkapitel«Zones of Care, Zones of Conflict», dass Care nicht automatisch friedlich, selbstlos oder positiv ist, sondern auch konflikthaft und widersprüchlich sein kann. Wie definierst Du Care für dich und wie verstehst Du dieses Spannungsfeld zwischen normativem Anspruch und konflikthaften Realitäten?
Bailer: Zentral am Care-Begriff ist eigentlich das Verständnis, dass wir alle in Fürsorgebeziehungen stehen und, dass Care die Grundlage von menschlicher Existenz ist. Und so schön und leicht romantisierbar dieser Gedanke ist, müssen wir auch verstehen, dass diese Fürsorgebeziehungen ein Feld sind, in dem sehr viele Ungleichheiten existieren. Zudem können diese sozialen Ungleichheiten, durch die Art und Weise wie wir gesellschaftlich Care organisieren, verstärkt werden. So sehen wir zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht, dass weiblich sozialisierte Personen deutlich mehr unbezahlte Fürsorgearbeit leisten, was sich dann auf ihre politische und ökonomische Teilhabe auswirkt und zum Beispiel vermehrte Altersarmut bei Frauen bedingt. Aber diese Ungleichheit zeigt sich auch in Bezug auf soziale Herkunft und Migration. Das Phänomen der «transnationalen Sorgeketten» beschreibt,
dass wir im Globalen Norden ein Care-Defizit haben, das wir mit Arbeitskräften aus dem Globalen Süden auszugleichen versuchen. Das Resultat ist, dass Menschen aus dem Globalen Süden oder auch aus Osteuropa für prekäre Arbeit in der Pflege in Deutschland oder der Schweiz ihre eigenen Familien und Pflege-Sektoren zurücklassen und so ein Care-Defizit in ärmeren Ländern entsteht, das ungedeckt bleibt. Das heisst, wir haben sehr viel Konfliktpotenzial und Ungleichheiten, die sich um Care entspinnen. Wenn wir also dafür plädieren, dass wir mehr Care brauchen, dann müssen wir uns immer fragen: «Wer leistet dieses Mehr an Care?» Denn Care ist keine Ressource, die wir endlos skalieren können.
Geniale: Siehst Du Wege, wie wir innerhalb von diesen systemischen Rahmenbedingungen Veränderungen im Kultursektor anstossen können, ohne, dass dies primär Mehrarbeit für FLINTA und BIPOC Personen bedeutet?
Bailer: Das ist ein zentraler Konfliktpunkt und ich bin mir nicht sicher, ob der sich so einfach auflösen lässt. Ich glaube, dass es, zumindest zu Beginn, wenn sich ein Team zum ersten Mal mit Care-Dynamiken in der Organisation beschäftigt, einen Mehraufwand bedeutet, weil man sich dem Thema widmen und eigene Dynamiken oder Annahmen reflektieren muss. Jedoch muss dies nicht bedeuten, dass dann für alle dauerhaft ein höherer Arbeitsaufwand entsteht, sondern vielmehr, dass der bestehende Arbeitsaufwand anders, ja gerechter, aufgeteilt wird – und somit FLINTA und BIPOC Personen längerfristig auch entlastet werden können, weil sie innerhalb einer Organisation nicht mehr als «Caregivers per default» verstanden werden.
Meine These ist, dass wir diesen Auftrag zur Fürsorge auf die Menschen im Kunstfeld ausweiten müssen, damit sie Teil von diesem Kunstsystem sein können. Ich plädiere daher für eine Verschiebung in der Kunst von «object care» hin zu «people care».
Ich plädiere in meinem Buch dafür, dass wir Care als Werkzeug verstehen, als eine Methode, die von Kurator*innen und von anderen Personen, die im Kultursektor arbeiten, angewendet werden kann, um ihrer Aufgabe tatsächlich gerecht zu werden. Das Wort kuratieren kommt vom lateinischen curare (dt. sich kümmern, fürsorgen, pflegen) und wird historisch verstanden als ein Kümmern um Kunstobjekte, um Sammlungsbestände. Meine These ist, dass wir diesen Auftrag zur Fürsorge auf die Menschen im Kunstfeld ausweiten müssen, damit sie Teil von diesem Kunstsystem sein können. Ich plädiere daher für eine Verschiebung in der Kunst von «object care» hin zu «people care».
Geniale: Care ist unter anderem deswegen so politisch, weil sie uns zwingt, unsere eigene Vulnerabilität und gegenseitige Abhängigkeit anzuerkennen. Wieso fällt es uns das so schwer? Und welches transformative Potenzial würde in der Thematik rund um Care stecken, wenn wir alle unsere Vulnerabilität annehmen würden?
Bailer: Ich glaube, es gibt zwei Ebenen, auf denen mentale Hürden entstehen, die uns zunächst daran hindern, unsere eigene Vulnerabilität wahrzunehmen. Einmal herrscht ein persönliches Selbstverständnis vor, dass wir nicht abhängig seien von anderen Menschen, dass Hilfe von anderen zu brauchen eine Schwäche und per se schlecht sei. Das Ideal der Unabhängigkeit steckt tief in uns drin und wird gesellschaftlich als Ziel propagiert. Die andere Ebene ist, dass es für sehr viele Menschen bequem ist, den Status quo aufrechtzuerhalten. Wir haben ein gesellschaftliches System, bei dem Frauen von klein auf beigebracht wird, in diese Fürsorgerollen hineinzuschlüpfen, angefangen mit Puppenspielen oder der Idealisierung der Ehe und dem Kinderkriegen.
Feministische Theoretikerinnen der 1960er und 70er Jahre vertraten den Standpunkt, dass Sorgearbeit nicht einfach «Arbeit aus Liebe» ist, sondern, dass diese schlecht bis unbezahlte Arbeit die Grundlage von jeglichem Wirtschaften darstellt. Das haben wir in der Pandemie live gesehen: Wenn Kinderbetreuung, Schule und Altenpflege wegfallen, dann fällt letztendlich auch unser Wirtschaftssystem zusammen, weil mittelfristig keine Erwerbstätigkeit ohne einen funktionierenden Care-Sektor – privat als auch öffentlich – funktionieren kann. Hier braucht es ein Umdenken über die soziale, politische und ökonomische Rolle von Sorgearbeit und auch über Geschlechterrollen. Denn eine Transformation von unbezahlter und bezahlter Care-Arbeit birgt das Potenzial für Veränderungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen. So kann eine geschlechtergerechte Aufteilung von den Lasten der Sorgearbeit – auch unter dem Schlagwort «Equal Care» bekannt – letztendlich ein möglicher Schlüssel zu einem gleichberechtigteren gesellschaftlichen Miteinander sein.
Geniale: Du entwickelst in Deiner Monografie das Konzept der «Caring Infrastructures». Kannst Du für uns kurz zusammenfassen, was Du darunter verstehst, vielleicht insbesondere auch in Abgrenzung zum Institutionsbegriff?
Bailer: Für mich war es wichtig, einen Begriff zu entwickeln, der Care nicht nur diskursiv verhandelt, sondern der deutlich macht, dass Care auch praktisch umgesetzt werden muss – also in unseren alltäglichen Strukturen und ganz konkret im Kultursektor. Caring Infrastructures meint genau das: Care als etwas zu verstehen, das wir in unsere bestehenden Strukturen einschreiben müssen, als einen grundlegenden Bestandteil unserer physischen und sozialen Gefüge.
Der Begriff Infrastruktur war mir dabei wichtig, weil er weiter geht als der klassische Institutionsbegriff. Institutionen können zwar Teil dieser Infrastrukturen sein, aber sie greifen allein zu kurz. Wenn wir zum Beispiel über ein Museum sprechen, dann endet die Selbstkritik der Institution oft, wo das Gebäude des Museums aufhört. Unsere sozialen Beziehungen, die verschiedenen Publikumsgruppen, kulturpolitischen Rahmenbedingungen und theoretischen Diskurse, in die Kunst ja eingebettet ist, all das reicht weit über die Gemäuer eines Kunsthauses hinaus und muss daher in eine kritische Betrachtung miteinbezogen werden.
Was mich daran besonders interessiert, ist das Veränderungspotenzial, das Infrastrukturen mit sich bringen.
Das Denken aus der Warte von Infrastrukturen macht diese Verbindungen sichtbar: zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen, zwischen Institutionen, aber auch zwischen kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten. Auch kuratorische Praxis ist in diesem Sinne eine infrastrukturelle Praxis, weil sie Bedingungen schafft, unter denen künstlerisches Arbeiten überhaupt möglich und sichtbar wird. Was mich daran besonders interessiert, ist das Veränderungspotenzial, das Infrastrukturen mit sich bringen. Wenn ich an einer Stellschraube in diesem Gefüge etwas verschiebe, dann kann sich das auf viele andere Punkte in einem infrastrukturellen Netz mit auswirken. Caring Infrastructures gehen deshalb über eine starre Vorstellung von Institutionen mit ihren Gemäuern und Sammlungen hinaus und beziehen soziale, diskursive, materielle und politische Ebenen in die Veränderungsprozesse mit ein.
Geniale: Zum Ende Deiner Monografie entwickelst Du ein «Soft-Manifesto», in dem Du Kurator*innen Input gibst, wie sie ihr Kuratieren oder auch ihre Organisationen zu einer Caring Infrastructure transformieren können. Ich denke aber, dass diese Inputs weit über den Kulturbetrieb hinaus relevant sein können. Warum ein Soft-Manifesto und nicht einfach ein Manifest?
Bailer: Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt eine Institution leiten würde und ich würde dieses Manifest lesen, wie müsste es geschrieben sein, damit ich nicht in eine Abwehrhaltung gehe, sondern mich abgeholt fühle? Ich wollte nicht ein Manifest im lauten, schrillen Sinn verfassen, sondern eher eine Art Einladung entwickeln, die sagt: «Schaut mal, das sind konkrete Praktiken, die in meinem Kontext gut funktioniert haben. Ich möchte diese anbieten und dazu einladen, euch anzuschliessen, zu schauen, kann das in meinem Kontext funktionieren? Was müsste ich vielleicht adaptieren?»
Ich verstehe den Begriff der Softness als eine Art subversive Praxis, also dass man Leute durch die Hintertüre in die Care-Thematik hinein holt, die sonst vielleicht einfach erst mal gesagt hätten «das tangiert mich nicht» oder «das brauche ich nicht», weil dann häufig doch diese Selbstverständnisse vorherrschen, dass wir ja unabhängig voneinander seien und keine Hilfe oder Care bräuchten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Buch zeigt: Care geht uns alle was an, wir alle sind Teil von Fürsorge-Beziehungen und es gehört zu unserem Berufsfeld als Kulturschaffende dazu, immer wieder neu auszuhandeln, wie wir Fürsorge in unseren jeweiligen Kontexten in die Praxis umsetzen können.
Bemerkungen
[1] Care-Givers: Menschen, die Pflege- und Fürsorgearbeit leisten. Beispielsweise Eltern oder Menschen, die Angehörige pflegen, aber auch Menschen, die in der Pflege oder der Kinderbetreuung arbeiten.
Care-Receivers: Menschen, die auf Fürsorgearbeit angewiesen sind, beispielsweise Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen und Kinder.
Beitragsbild: Sascia Bailer 2023, Foto: Constantin Ranke.



